Essay Geholfen
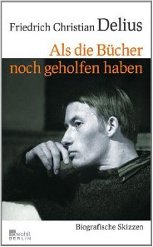 Als die Bücher noch geholfen haben
Als die Bücher noch geholfen haben
Biografische Skizzen
304 Seiten, mit 25 s/w-Abbildungen, gebunden
€ 18,95
ISBN 978-3-87134-735-1
rororo taschenbuch Werkausgabe
336 Seiten, € 9,99
ISBN 978-3-499-26782-6
Welches war der verrückteste Moment in der Literaturgeschichte seit 1945? Warum verliebte sich ein junger deutscher Autor in Susan Sontag? Wie veränderten die Schüsse der sechziger Jahre die Sprache? Wie spielte Rudi Dutschke Fußball? Was war so attraktiv am Kollektiv? Warum klagte ein Konzern wie Siemens gegen eine Satire? Wie wurde Literatur durch die Berliner Mauer geschmuggelt?
Seit fast fünf Jahrzehnten ist Friedrich Christian Delius Akteur und Beobachter des deutschen Geisteslebens. Schon mit einundzwanzig las er vor der Gruppe 47, wurde wenige Jahre später Lektor bei Wagenbach, dann bei Rotbuch. Er erlebte Sternstunden und Tiefpunkte der Linken sowie ihre Zerrissenheit angesichts des beginnenden RAF-Terrors. Mit seinen Romanen wurde er zum poetischen Chronisten deutscher Zustände – wobei er die Kunst stets gegen die Politik verteidigte.In seinem Erinnerungsband liefert Delius bestechende Deutungen der tiefen politischen Spaltungen von den Sechzigern bis zur Wendezeit, zeichnet Porträts von Weggefährten und Autoren wie Wolf Biermann, Heiner Müller oder Günter Kunert, Nicolas Born, Thomas Brasch oder Herta Müller und spricht über das Glück der Literatur. Ein ebenso persönliches wie eindrucksvolles Zeugnis einer Epoche.
Leseprobe bei perlentaucher
*
Pressestimmen:
„Ein großartiges Buch“, Fritz J. Raddatz in „Welt am Sonntag“
„die beste und anschaulichste Literaturgeschichte, die ich mir denken kann“ (Claudia Schmölders)
„… Stücke aus der Irrsinnsgeschichte der Bundesrepublik.“ (FAZ)
„Beim Abbau von Ressentiments könnte der jetzt bei Rowohlt Berlin erschienene biografische Erzählband von F. C. Delius mit dem schönen Titel ,Als die Bücher noch geholfen haben‘ entscheidend helfen. Also rein in die bundesdeutsche (Literatur-) Geschichte …“ (Der Freitag)
„Es ist das Selbstbild eines Schriftstellers, der ein getreulicher Chronist seiner Generation ist, gewiss aber nicht ihr Repräsentant. Der sich geradezu mit protestantischer Freude in den Dienst seiner Sache gestellt hat und die Manuskripte Heiner Müllers, Thomas Braschs, Günter Kunerts unter seiner Kleidung verborgen in den Westen geschmuggelt hat. Der Bote Delius wird zum Sinnbild einer literarischen Existenz, die sich nicht im Schreiben erschöpft und im Ermöglichen, Vermitteln eine Erfüllung findet. Und dieses Buch erzählt mit derart stiller Freude vom Glück des Gelingens, dass … Delius‘ alte Lachkumpels sich vor Vergnügen die Bäuche halten müssten.“
(Hans-Jost Weyandt, Spiegel-online)
„Dieses Erinnerungsbuch lehrt uns viel über jene Zeit des Aufbruchs. Sie verlief komplex, eigen und viel weniger nach verordnetem Programm, als das die Ideologen von einst und heute gerne sähen. Spielerisch konnte sie sein, undogmatisch, literarisch im guten, weil offenen, nicht zum Vornherein festgelegten Sinn. Die genau berichteten Geschichten aus Delius‘ Wirken als Autor und Lektor machen klar, dass sie gerade jetzt erzählt werden müssen.“
(Beatrice von Matt, Neue Zürcher Zeitung, 09.06.2012)
„Eine Fundgrube!“ (NZZ am Sonntag)
„Delius ist ein herausragender Zeitzeuge. Er verkörpert die bundesdeutsche Entwicklung durch einen biografischen Umstand, der wie eine Kreisbewegung anmutet. (…) Wie sehr sich bei ihm literarischer Impetus und politische Haltung durchdringen, wird in seiner Dankesrede zum Büchnerpreis 2011 deutlich. Sie steht, lesbar als Poetik des Autors, programmatisch am Schluss. Gäbe es noch Lesebücher, dieser Text müsste drinstehen.“
(Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung)
*
Schweigen, stürmen, schreiben
Ein Zeitzeuge des Literaturbetriebs: Friedrich Christian Delius‘ biografische Skizzen „Als die Bücher noch geholfen haben“
Friedrich Christian Delius hat Zeit seines Lebens dagegen angekämpft, als typischer 68er zu gelten. Und das fing schon vor 1968 an: er stand im Februar 1966 bei einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg vor dem Amerikahaus in Westberlin und ertappte sich dabei, nur Zuschauer zu sein. Es ist eine Pointe der bundesdeutschen Literaturgeschichte, dass ausgerechnet er, der hessische Pfarrerssohn, der sich immer dezidiert als Literat begriff und in den engeren Zirkeln als „Schweiger“ auffiel, früh den Ruf eines der größten Revoluzzer hatte.
Es waren zwei gesellschaftskritische Dokumentationstexte im Agitprop-Stil, die Delius berühmt machten: „Unsere Siemens-Welt“, eine fingierte Festschrift, die zum ersten Mal die Rolle dieses Unternehmens im NS-Staat thematisierte, sowie die „Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende“, eine Satire über den damaligen „Kaufhauskönig“. Beide Texte nahmen charakteristische kapitalistische Machenschaften ins Visier und zogen endlose Gerichtsverfahren nach sich. In Delius‘ biografischen Skizzen werden nun die Umstände dieser Prozesse genau geschildert. Sie führen eine Zeit vor Augen, die heute unendlich weit weggerückt zu sein scheint – genauso weit wie der Nationalsozialismus oder eine Unternehmensführung, die noch keine professionalisierten Kommunikations- und Marketingabteilungen hatte. Für Delius ist es vor allem ein schlagender Beleg für den Titel seiner Erinnerungen: „Als die Bücher noch geholfen haben“.
Es geht ihm in erster Linie immer um die Möglichkeiten von Literatur, also auch um den Beweis, „dass ich über einen Weltkonzern sprachlich verfügte“. Die Aufbruchszeit der sechziger Jahre, das Politexperiment Westberlin, die linken Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund des „realen Sozialismus“ im Ostblock: Delius schildert das alles in einem zurückhaltenden, milden Ton als Schauplatz eines auf die Literatur bezogenen Lebens. Ab einem bestimmten Punkt nannte er sich dann nicht mehr vorwärtsstürmend „FC Delius“, dem Aufreißen utopischer Horizonte entsprechend, sondern griff auf das solide „Friedrich Christian Delius“ zurück. Das entsprach auch einer Änderung des ästhetischen Programms.
Delius ist ein herausragender Zeitzeuge. Er verkörpert die bundesdeutsche Entwicklung durch einen biografischen Umstand, der wie eine Kreisbewegung anmutet. Als kaum 21-Jähriger nahm er nämlich bereits 1964 an einer Tagung der Gruppe 47 teil, die damals auf dem Höhepunkt ihres Einflusses stand – und 1990, lange nach deren offiziellem Ende, als noch einmal eine allerletzte Ausnahmetagung bei Prag organisiert wurde, war er der letzte Schriftsteller, der dort las. Delius, so wortkarg wie er auch wirkte, war immer auf andere Autoren bezogen, das frappiert in seinen Erinnerungen besonders: die Arbeit als Lektor spielte von Anfang an eine große Rolle. Es begann damit, dass Klaus Wagenbach einmal nachts über den Bauzaun bei Delius‘ Hinterhofwohnung und ihm ein dickes Manuskript vorbeibrachte: dem Autor müsse am nächsten Tag Bescheid gesagt werden, sonst gehe er zu einem anderen Verlag, und er selbst sei sich nicht sicher und müsse darüber diskutieren. Später hatte Delius großen Anteil an der Entdeckung Heiner Müllers im Westen, er verantwortete dessen Werkausgabe in Einzelbänden beim Rotbuch-Verlag, und auch der als sensationell aufgenommene Debütband von Thomas Brasch ging auf Delius‘ Initiative und Werben zurück. Der genaue Blick dieses Autors für die Qualitäten bei anderen, gerade auch wenn sie ästhetisch ganz andere Wege beschritten als er selbst, nützte ihm ganz offenkundig auch bei der Arbeit an eigenen Texten.
Manche Szenen werden zur Allegorie. Peter Handkes kalkulierter Happening-Auftritt bei der Gruppe 47 in Princeton 1966 hat nicht nur den fast gleichaltrigen Delius überrumpelt. Und dass sich damals alle sofort in die schöne amerikanische Intellektuelle Susan Sontag verliebten, wirft von ganz anderer Seite her ein Licht auf die damalige deutsche Lage. Delius merkte plötzlich, fast erschaudernd: „Ästhetik und Demokratie passen zusammen.“ Deswegen bezeichnet er sich allenfalls als „66er“ und nicht als „68er“: die Offenheit, das Ausprobieren, die Lust an neuen Formen vor der dogmatischen Erstarrung sind das, worauf er sich noch heute beziehen möchte.
Diese große Linie überdeckt einige Brüche und Widersprüche, die es auch bei ihm gegeben haben muss, die er aber spürbar hintanstellt. Aufschlussreich ist etwa seine Darstellung des großen Schismas, das Mitte der siebziger Jahre die literarische und politische Szene erschütterte: der Streit im Wagenbach-Kollektiv, der in einem getrennten Wagenbach- und Rotbuch-Verlag endete. Erstaunlich war dabei, dass der vermeintlich radikalere, den Kollektiv-Gedanken konsequent weiterführende Rotbuch-Verlag ausgerechnet für die literarischen Autoren verlockender zu sein schien. Delius schildert nun detailliert – und das ist eine bisher unbekannte Sicht der Dinge – dass sich die Geister an der Haltung zur „Rote Armee Fraktion“ schieden, der Baader/Meinhof-Gruppe. Vor allem der Politiklektor bei Wagenbach, aber auch der von der Autorin Meinhof faszinierte Wagenbach selbst seien davon affiziert gewesen. „Das erste Opfer der RAF waren Witz und Spott“, stellt Delius fest, und seine begeisterte Darstellung des Rotbuch-Kollektivs, das sehr gut funktioniert habe, zeigt indirekt, wie die Wunden von damals immer noch weiterwirken. Es ist aber bemerkenswert, wie sehr er sich um eine ausgewogene Haltung gegenüber Klaus Wagenbach bemüht – bei allen Verletzungen lässt Delius keinen Zweifel an den Verdiensten des Verlegers.
Eine notwendige Geschichtslektion erteilt der Autor, wenn er zeigt, dass es gerade die undogmatische westliche Linke war, die die Dissidenten im Ostblock vorbehaltlos unterstützt und sie überhaupt erst bekanntgemacht hat. Seine Beschreibung des Moskauer Küchentischs von Lew Kopelew und der Begegnung mit dem deutschrumänischen Dichterzirkel um Herta Müller beeindruckt durch die Klarsicht abseits offizieller Polit-Delegationen. Und es war auch ausgerechnet der Rotbuch-Verlag, der die schonungsloseste Abrechnung mit der Unterdrückung der Arbeiter im „realen Sozialismus“ veröffentlichte, nämlich „Stücklohn“ von Miklós Haraszti. Dass „linksliberal“ nach 1989 bald zum Schimpfwort wurde, ist eine der vertracktesten Wendungen der Geschichte – und Delius hält dabei an einer Haltung fest, die angesichts etlicher opportunistischer Wendehälse in seiner Generation als redlich erscheint, abseits jeglichen Zynismus. Wie sehr sich bei ihm literarischer Impetus und politische Haltung durchdringen, wird in seiner Dankesrede zum Büchnerpreis 2011 deutlich. Sie steht, lesbar als Poetik des Autors, programmatisch am Schluss. „Butzbach“, ein in seiner hessisch-provinziellen Anmutung schon sehr früh von Delius benutzter Topos, dient hier als Moment des Nachdenkens über Büchner und mögliche Bezüge zu heute. Gäbe es noch Lesebücher – dieser Text müsste drinstehen.
(Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung, 20. April 2012)
*
Ingo Schulze: Begrüßung der „Biografischen Skizzen“ und ihres Autors
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
mein Name ist Ingo Schulze und ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Akademie der Künste willkommen heißen. Ein besonders herzliches Willkommen gilt Friedrich Christian Delius, dessen Biografische Skizzen, wie es zurückhaltend im Untertitel heißt, wir heute vorstellen dürfen. Als die Bücher noch geholfen haben lautet der Titel, und der ist, wenn nicht gar unverschämt, so doch zumindest eine Provokation. Unweigerlich hört man den Satz „Als das Wünschen noch geholfen hat“ dabei mit, eine Grimmsche Wendung, (und ein Buchtitel von Peter Handke) die auf eine Zeit vor unserer Zeit verweist, eine Epoche, die in märchenhafte Ferne gerückt ist, in der andere Gesetze galten und alles möglich schien. Und in gewisser Weise stimmt das (und stimmt natürlich auch nicht), denn das Buch umspannt grob gesagt die Zeit von 1964 bis 1988. Es beginnt nach dem Bau der Berliner Mauer und endet vor ihrem Fall, auch wenn der immer mitgedacht, eine Art Schlusspunkt bildet.
Nähmen wir den Autor beim Wort, so müssten wir schlussfolgern: Dieses Buch, erschienen im März 2012, gehört eindeutig nicht mehr der von Friedrich Christian Delius bezeichneten Epoche an, in der Bücher noch geholfen haben. So gesehen, meine Damen und Herren, sind Sie heute Abend vergeblich gekommen, es tut mir leid, dieses Buch wird Ihnen und uns nicht helfen. Oder erwarten Sie das gar nicht von Büchern?
Ich hatte mir von diesem Buch etwas Anderes erwartet. Denn ich hatte geglaubt, mit Leben und Werk von Friedrich Christian Delius halbwegs vertraut zu sein. Nun weiß ich: Ich hatte keine Ahnung. Fast alles war mir neu. Und selbst die Dinge, von denen man von ihm oder anderen so erzählt bekommen hat, hatte ich nicht in ihrer Bedeutung begriffen.
Für die hier beschriebene Zeit überfiel mich der Verdacht, es mit einem literarischen Forrest Gump zu tun zu haben. Sie kennen ja vielleicht den Film mit Tom Hanks, der als Forrest Gump an allen entscheidenden Momenten der jüngeren amerikanischen Geschichte beteiligt war, von Elvis bis Watergate. Das Buch von Friedrich Christian Delius liest sich auf Deutschland bezogen ähnlich. Natürlich geht es meist um das literarische Leben, aber das darf mitunter exemplarisch genommen werden.
Ich kannte und schätzte und kenne und schätze ihn als Romanautor und habe das Glück, wie etliche andere mit mir, in ihm einen Kollegen im wahrsten Wortsinne zu haben – um die Tautologie eines kollegialen Kollegen zu vermeiden.
In diesem Buch begegnet man vor allem dem Dichter und dem Lektor und dem Kämpfer. Als Dichter bei der Gruppe 47, als Lektor bei Wagenbach und Rotbuch und bei wöchentlichen Besuchen in Ostberlin, vor Gericht mit Siemens und Horten. Das Kollegiale seiner Art und Weise zu leben, bleibt implizit. Man begreift, dass hier einer nicht nur ein haltbares literarisches Werk geschaffen hat, das die deutsche Geschichte der letzten siebzig bis achtzig Jahre umfasst, sondern dass seine Begabung, sein Gespür in nicht unzählige, aber doch kaum zu zählende Bücher, eingeflossen ist. Und es ist für mich mehr als eine Fußnote, dass dieses Buch wiederum seinen Lektoren gewidmet ist.
Die Haltung von Friedrich Christian Delius scheint mir am besten mit einem Satz Michael Hamburgers bezeichnet zu sein. Hamburger, der große Lyriker und Übersetzer und Vermittler deutscher Literatur in England, schreibt an seinen Freund und Kollegen Johannes Bobrowski, dass es ihm weniger wichtig vorkommt, wer die Gedichte schreibt. Wichtig ist, so ließe sich hinzufügen, dass sie geschrieben werden.
Bewundernswert ist, wie Friedrich Christian Delius gegen die Legendenbildung arbeitet. Das liegt an der Genauigkeit und Uneitelkeit des Autors. Er spart nicht mit Dank und Bewunderung, verhehlt aber auch nicht seine Enttäuschungen. Er selbst ist nie nur der Beobachter, er ist immer selbst betroffen und dann mitunter derjenige, der am ratlosesten zurückbleibt.
Für jemanden, der diese Zeit zum Teil nicht bewusst miterlebt hat und von der westlichen Welt oft nur das abendliche Rauschen auf Mittelwelle vernahm, dem aber die Geschichte des Westens über Nacht zur eigenen Geschichte wurde, die sich als mindestens so bestimmend wie das selbst Erlebte, wenn nicht als dominanter als dieses für seinen heutigen Alltag erweist, für den ist so ein Buch unentbehrlich.
Friedrich Christian Delius denkt nicht nur Ost und West zusammen – so sagt er, dass die Niederschlagung des Prager Frühlings als Enttäuschung und Desillusionierung noch immer unterschätzt wird –, er führt es auch höchst konkret zusammen, in dem er in den Jahren als Lektor praktisch jede Woche nach Ostberlin fährt. Man kann nichts über das eine Deutschland sagen, ohne über das andere ebenfalls zu sprechen. Als Leser wünschte ich mir noch viel mehr solcher Porträts, wie er sie von Günter Kunert, Wolf Biermann, Heiner Müller oder Thomas Brasch zeichnet.
Womöglich aber ist dieses Buch gar für diejenigen, die all das miterlebt haben und vielleicht sogar noch in Berlin, dem Schauplatz des Buches, noch sehr viel erhellender und bereichernder, weil es sich mit ganz unmittelbaren Erfahrungen vergleichen lässt.
Aber so, wie ich gerade über das Buch sprach, enge ich es schon zu sehr ein. Denn diese biografischen Skizzen haben auch eine literarische Dimension. Dazu gehört, dass hier jemand viel von sich preisgibt und sich dadurch auch anfechtbar macht – doch gerade durch die Unsicherheiten und Schwächen oder vermeintlichen Schwächen des Protagonisten werden die Konturen der Welt, die er beschreibt, nur umso schärfer. Er schreibt: „Der SDS war nichts für Lyriker. Andere politische Gruppen auch nicht. Ich konnte mir erlauben, ein Einzelgänger zu bleiben, durfte es nur nicht zu laut sagen.“ Und an anderer Stelle heißt es lakonisch: „Ich habe mich doch nicht mühsam vom Kirchenlied emanzipiert, um jetzt neue politische Kirchenlieder zu schreiben.“
Ich möchte aber auch noch ausdrücklich sagen – und das spare ich mir nicht für das Gespräch auf, sondern verkünde es bewusst hier von der Kanzel: Du schuldest uns eine Fortsetzung! Denn von Dir beschrieben zu bekommen, wie durch die Brechungen von 1989/90 sich die Menschen und Verhältnisse geändert haben, darauf möchte ich ungern verzichten. Aber diesem Satz darfst Du gleich widersprechen. Widersprüche – in der mehrfachen Bedeutung dieses Wortes – hätte auch ein Titel sein können. Ich wage das zu sagen, weil ein Leitmotiv des Buches eine Sentenz von Friedrich Schlegel ist, die Friedrich Christian Delius mindestens zweimal zitiert: „Jeder Satz, jedes Buch, so sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig“. Dieser Satz, schreibt Delius, habe ihn in gewisser Weise beschützt. Und er rettet ihn auch heute Abend wieder. Denn Als die Bücher noch geholfen haben ist bei aller Unvollständigkeit auch ein vollständiges Buch, denn es widerspricht seinem Titel, es führt ihn in seinem Verweis auf die Vergangenheit aufs Schönste ad absurdum.
(Begrüßung bei der Buchvorstellung mit Helmut Böttiger in der Akademie der Künste Berlin am 9. März 2012)
*